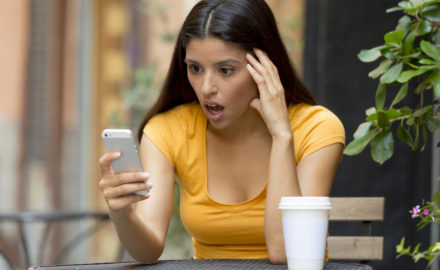WARUM STARRST DU STÄNDIG AUF DEIN SMARTPHONE?
Durch das Internet wurde die Möglichkeit zu kommunizieren vervielfacht. Wir schreiben jetzt «one to many» und nicht mehr «one to one» wie in einem persönlichen Brief oder einer persönlichen E-Mail.
Zwei wichtige Aspekte dieser Kommunikationsform sind die Selbstdarstellung und die Aktualität. Erstens versuchen wir uns in unseren Beiträgen immer von der besten Seite zu zeigen, und zweitens geht es darum, möglichst immer aktuell zu sein.
Freilich ist damit die Frage noch nicht beantwortet, woher der Drang nach Selbstdarstellung bzw. Aktualitätsvermittlung kommt. Forscher wollen herausgefunden haben, dass die Angst, etwas zu verpassen, wie auch die Sorge, nicht auf dem Laufenden zu sein, viele dazu zwingt, ständig auf ihr Handy zu schauen. Natürlich weiss jeder, dass er im Grunde nichts verpassen kann. Entscheidend ist vielmehr das bohrende Gefühl, etwas verpasst zu haben. (Der Eindruck, diese Angst habe sich in den letzten Jahren unter dem Einfluss digitaler Medien und mobiler Kommunikationsmittel verstärkt, ist verbreitet. Freunde sind ortsunabhängig in Echtzeit verbunden. Noch nie war es so leicht, abwesend und doch informiert zu sein. – Diese Angst hat im Übrigen bereits einen Namen erhalten: FOMO – FEAR OF MISSING OUT.)
Vermutlich kennen das fast alle: Wer sich schlecht oder gelangweilt fühlt, checkt sein Smartphone. Er surft ziellos durch die Gegend, was freilich das schlechte Gefühl nur verstärkt. Untersuchungen haben gezeigt, dass, wer unter schlechter Stimmung leidet oder mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden ist, FOMO umso stärker empfindet. Und die Angst, etwas zu verpassen oder verpasst zu haben, führt wiederum zu intensiverer Nutzung von Social Media. Allerdings reduziert diese Mediennutzung das Gefühl von FOMO nicht, sondern verstärkt es und führt zu weiterem Engagement in sozialen Netzwerken. Das Leben anderer erscheint auf Social Media wie Facebook oder Twitter stets besser als das eigene. Wer die Freunde ständig dabei beobachtet, wie sie mit wunderbaren Menschen am Strand in fernen Ländern den Sommer verbringen, kann nur Ungenügen empfinden. Kommt hinzu, dass, wer wissen will, was seine Freunde erleben, sich bei Facebook, Twitter oder Instagram informieren muss. Er kann also nicht mehr erwarten, vor Zusammenkünften ein Update zu erhalten.
Peter Sloterdijk fasst das oben ausgeführte Phänomen wie folgt zusammen: Im 21. Jahrhundert gilt nicht mehr «Ich denke, also bin ich», sondern «Man denkt an mich, also bin ich». Dies ist freilich nur möglich, weil die elektronischen Medien das «one to many» erleichtern, womit nochmals die Medientheorie von Marshall McLuhan aus dem letzten Jahrhundert ihre Bestätigung erfährt: «The medium is the message.»
Christoph Frei, Akademisches Lektorat, CH-8032 Zürich